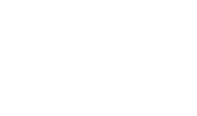Mit einer unsichtbaren Behinderung zu leben, ist im regulären Alltag schon eine Herausforderung, doch in Zeiten einer weltweiten Pandemie ist der Stress, der auf uns lastet, oft nur schwer zu ertragen.
Neben der Angst, dass sich geliebte Menschen mit dem Coronavirus infizieren, oder man selbst schwer erkrankt, vielleicht sogar stirbt, hat sich in den letzten Wochen vor allem auch die Haltung unser nicht behinderten Mitmenschen gegenüber Menschen mit Behinderungen – vor allem die, die zur Risikogruppe gehören – stark verändert.
Unsichtbare Behinderung sorgt für Unverständnis
In meinem Alltag bin ich ständig mit Ableismus konfrontiert. Das fängt beim Reisen an und hört bei der Ausbildung auf. Am Flughafen werde ich oft dumm angeredet oder mindestens schief angeschaut, wenn ich einen Rollstuhl nutze, dann aber aufstehe und zur Toilette laufe. Als ich vor zwei Jahren Journalismus studieren wollte, wurde mir von 99 Prozent der Universitäten gesagt, ein Onlinestudium wäre keine Option. Das wäre viel zu aufwendig für eine Studentin mit Behinderung.
In Bezug auf unsichtbare Behinderungen bestehen so viele Missverständnisse gemäß dem Motto ‘was man nicht sieht, das gibt’s auch nicht’. Seit über zehn Jahren lebe ich mit mehreren chronischen Erkrankungen, die zu chronischen Schmerzen und einfach ausgedrückt, instabilen Gelenken führen. Keiner meiner Tage sieht gleich aus. Manchmal brauche ich Hilfsmittel, wie einen Rollstuhl oder Bandagen. An anderen Tagen kann ich normal gehen. Das ist für viele Menschen unverständlich. Sie denken, einen Rollstuhl hast du nur zu nutzen, wenn du deine Beine nicht bewegen kannst. Sie verstehen auch nicht, warum man als Mensch mit Behinderung studieren will, wenn unsere Leben doch auch so schon anstrengend und bemitleidenswert genug sind.
Ist die Zielgruppe groß, ist vieles möglich
Doch dann trifft uns diese Pandemie und innerhalb von wenigen Tagen können Universitäten ihre Vorlesungen komplett online geben, weil plötzlich 100 Prozent der Studenten betroffenen sind und nicht mehr nur eine Minderheit. Für viele Menschen mit Behinderungen war das ein Schlag ins Gesicht. Während diese Notwendigkeit zumindest in Zukunft hoffentlich Vorteile für Behinderte bringt, macht der Großteil der von Corona hervorgerufenen Veränderungen unser Leben eher schwieriger.
Als die Pandemie sich langsam verbreitete und noch kaum jemand eine Maske trug, ging ich bereits mit N95-Schutz zum Einkaufen, da ich zur Risikogruppe gehöre. Weil ich jung und gesund aussehe, habe ich mir von mehreren Leuten anhören müssen, dass ich nicht so übertreiben solle und die Masken für alte Leute da seien. Auch zur extra eingerichteten Shoppingzeit für ältere und immungeschwächte Menschen konnte ich nicht gehen, da ich alles andere als chronisch krank aussehe. Nachdem alle Buslinien in meiner Gegend gestrichen wurden, habe ich die Wahl zwischen weite Strecken zu Fuß zurückzulegen, was tagelang Schmerzen bedeuten würde, oder meine Einkäufe liefern zu lassen, was exponentiell mehr Geld kostet, als ich eigentlich habe.
Proteste zeigen die geringe Solidarität
Das Schlimmste an der COVID-Pandemie für Menschen mit Behinderung ist allerdings nicht die Logistik oder die Belastung durch die Angst, die sich ergibt, wenn man zur Risikogruppe gehört. Es ist das völlige Unverständnis von Teilen der nicht behinderten Bevölkerung, die uns für weniger wertvoll halten und kein Problem damit hätten, uns sterben zu sehen, damit sie zurück zu ihrem normalen Leben kehren können. Damit sie ins Fitnessstudio, eine Bar, oder ins Kino können. Leute, die gegen die Maskenpflicht protestieren und bereitwillig ihre und die Gesundheit jedes anderen Menschen riskieren. Leute, die sagen, die ‘verwundbare’ Population könne ignoriert werden, weil sie ohnehin nichts zur Gesellschaft beitrage. Doch dieser Gedanke ist auf vielen Ebenen falsch und hochproblematisch
Wir behinderten Menschen sind es, die mit der Isolation und der Verpflichtung für alle anderen zuhause zu bleiben, Masken zu tragen und Hände zu desinfizieren, besser umgehen, als die meisten Menschen, die in ihrem Leben noch nie vor einer derartigen Herausforderung standen.
Wir sind es auch, die für andere da sind, Leute die mental straucheln unterstützen und der Gesellschaft zeigen, wie man mit einer plötzlichen massiven Veränderung des Lebens umgehen kann. Wir sind es, die den Rest der Bevölkerung schützen, weil wir verstehen, dass eine Maske keine Einschränkung ist, sondern ein Zeichen von Respekt für all die Menschen, die bereits verstorben sind oder diejenigen, die sich um die Schwerkranken kümmern. Und wir sind es auch, die am meisten zu verlieren haben und oft doch das Größtmögliche geben.
Was für manche gesunde, nicht behinderte Menschen gerade eine mittelschwere Unannehmlichkeit ist, ist für viele Behinderte schon lange vor der Pandemie Realität gewesen: Isolation, soziale Distanzierung und Ausschluss von vielen Aktivitäten, die für andere so normal sind.Menschen mit Behinderungen sind in dieser Pandemie nicht das Problem, sondern die Lösung.
Karina Sturm
studiert Journalismus in Edinburgh, Schottland. Mit einem Fokus auf Medizin, Wissenschaft, chronische Krankheit und Behinderung schreibt sie akademische Publikationen für Fachzeitschriften, Feature-Artikel und Reportagen für diverse deutsche und amerikanische Zeitungen und bloggt leidenschaftlich in ihrem deutschen Blog. Karina liebt Hunde, Heavy Metal, den Ozean und Essen aus aller Welt.